Aremberg und die Arenberger
Peter Weber
Mit zunehmendem Geschichtsbewußtsein und Rückbesinnung auf traditionelle Werte, wird von immer mehr Gemeinden die Genehmigung zur Führung eines Ortswappens beantragt. Die Gemeinde Aremberg tat dies auch im Hinblick auf die 900-Jahrfeier, die mit großem Einsatz des Bürgermeisters und Mitgliedern des Gemeinderates vorbereitet, und unter Teilnahme zahlreicher prominenter Gäste, auch aus der herzoglichen Familie, begangen wurde.
Das neue Ortswappen
Für die Gemeinde Aremberg waren die Voraussetzungen für die Wappendarstellung durch das Wappen der Herzöge von Arenberg, die ehemaligen Landesherren, gegeben. Neben der weltlichen Tradition der Gemeinde in vergangener Zeit sollte auch die kirchliche in dem Wappen zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig wurden die Farben der Arenberger, gold und rot verwendet. Nach diesen vorgegebenen Grundlagen wurden Entwürfe erstellt und eine Vorlage durch den Gemeinderat ausgewählt und zur Genehmigung eingereicht.
Das Wappen der Arenberger, über dessen Verleihung noch berichtet wird, zeigt auf rotem Grund drei goldene Mispelblüten. Eine Herzogs- oder Fürstenkrone mußte entfallen, weil ein genehmigtes Wappen gewissermaßen ein Hoheitszeichen ist und die vorgenannte Krone dem Geschlecht der Arenberger, nicht aber der Gemeinde Aremberg, zusteht. Um möglichst wenig Farben zu verwenden, wurden im oberen Teil des Wappens die gleichen Farben verwendet, drei rote Kugeln auf goldenem Grund. Diese drei Kugeln stehen für den hl. Nikolaus, den Pfarrpatron der Aremberger Pfarrkirche, der schon im Jahre 1306 genannt wird. Der Legende nach hat der hl. Nikolaus, Bischof von Myra, wahrscheinlich 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts, drei armen Mädchen drei goldene Kugeln als Mitgift ins Zimmer geworfen. Aus diesem Grunde gelten als Symbole des hl. Nikolaus, Bischof von Myra, drei Kugeln oder der Bischofshut. Auf den Bischofshut als Symbol wurde verzichtet, weil von vielen anderen Gemeinden, die einen hl. Bischof als Pfarrpatron haben, dieses Symbol verwendet werden kann.
Das von der Bezirksregierung genehmigte Wappen wird folgendermaßen beschrieben: »Unter goldenem Schildhaupt, darin drei rote Kugeln, in Rot drei goldene Mispeln«. Inzwischen fand es guten Anklang und wird auf Fahnen, Briefköpfen, Siegeln etc. an die Vergangenheit Arembergs erinnern.
Der Dorfname Aremberg
In letzter Zeit ist über die Geschichte der Herren von Arenberg mehrfach geschrieben worden, so in »Die Arenberger in der Eifel«, »Aremberg in Geschichte und Gegenwart« und anderen Publikationen. Was aber die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes Arembefg anbelangt, sind sich die Experten nicht ganz einig. In vielen alten Publikationen von »Eiflia illustrata« bis zum »Handbuch des Bistums Trier« ist das Jahr 1087 angegeben. Außerdem gibt es Veröffentlichungen, die jüngere Datierungen angeben und sich auf A. Fahne berufen oder Heinrich von Arberg angeben. Wie dem auch sei, die Gemeindevertreter haben sich für 1087 entschieden und die 900-Jahrfeier gestartet. Sie lagen damit auf der gleichen Linie wie Prof. F.-J. Heyen vom Landeshauptarchiv in Koblenz, der feststellte: Feiern kann man immer, dazu muß man kein historisch rundes Datum haben. Es gibt noch Vergangenheit aufzuspüren, die bislang durch den Steinwall am Berghang, durch Hügelgräber und die alte Römerstraße angedeutet wird, und es ist zu wünschen, daß sich Experten mit dieser sicherlich interessanten Aufgabe beschäftigen. Die Aremberger werden es dankbar begrüßen.
Die Herkunft der Arenberger
Durch die Angaben, die Prinz Jean von Arenberg in »Die Arenberger in der Eifel« gemacht hat und eine von Monika Weber besorgte Übersetzung ins Deutsche aus dem Compendium Express, Arenberg-Stiftung, Vaduz (FL), wurden neue Theorien über die Herkunft der Arenberger bekannt. Die von Prinz Jean von Arenberg erwähnte Wappenverleihung an Hartmann de Arberch, die von Forschern angezweifelt wird, findet in ähnlicher Form ihre Bestätigung in dem vorgenannten Compendium: »Wenn wir uns auf die fragmentarischen Anfänge beschränken, dann finden wir die ersten Spuren des Namens am Ufer der Rhône in der Bourgogne gegen 1821 auf einer Sarkophagplatte. Der Sarkophag hatte der Bestattung einer jungen Person namens d’Arenberga gedient. Die Platte ist von erheblichem Ausmaß, und die altchristliche Inschrift gibt neben anderen Details das Datum des Ablebens an: 25. Mai 501. Der Stein wurde 1970 ins Rathaus von Villebois, Departement de l’Ain, gebracht und 1974 in die Gruppe der Geschichtsdenkmäler aufgenommen.
Unter der Herrschaft der Könige Clotaire II. und Dagobert I., führte der „erste Herzog der Franken“ Arnebert (oder Arembert) Kriege. Er fand den Tod in einem Hinterhalt der Basken bei der Rückkehr von einem Straffeldzug in Basse-Navarre im Jahre 636. Dieses Ereignis verweist wortgetreu auf das berühmte Rolandlied. Es gibt keine unzweifelhafte Dokumentation, jedoch ist die Verwandtschaft dieser beiden Personen eine gesicherte Sache. Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Name d’Arenberg den unwahrscheinlichsten Verdrehungen unterworfen.
Gegen 900 wurde der Name d’Arenberg in die Eifel gebracht nach dem Erwerb eines „franc alleu“ (Gegensatz zum Lehen, Gebiet voll im Besitz und ohne Abgabe) in den Gebieten des Grafen Matfried. Dies bereitet die Ankunft der Familie in der ausgezeichneten erblichen Vogts-, Gouverneurs- und Militärkommandantenstelle der befestigten Metropole Köln vor. In seinem großen historischen Lexikon (1725) gibt Moren als Alternative zum Namen des Marktfleckens Aremberg/Eifel an: Arenberga oder die lateinische Version: Areburium. Ebenso der „Chanoin Vosgien“ (geographisches Werk von 1744).
Der Bischof von Lüttich, Richer (920-35), schickte Henri Oiseleur ein Kontingent von Reitern zu Hilfe, an deren Spitze Hartmann d’Arenberg stand. Im Verlauf des Kampfes gegen die Ungarn in Riade an der Unstrut wurde Hartmann schwer verletzt. Nicht mehr in der Lage, zu seinen Männern zu stoßen, schleppte er sich unter einen Mispelstrauch. Drei Blüten des gastlichen Strauches fielen auf seinen blutigen Schild und blieben dort in einer eigenartigen Stellung liegen. Als der König und der Bischof vorbeizogen, fanden sie den Helden ausgestreckt und leblos. Sie ließen ihn in geweihte Erde bringen und befahlen, daß der Schild seinem Sohn übergeben werde. Die Familie ließ diese Erinnerung in ihrem Wappen fortbestehen, auf dem die drei goldenen Mispelblüten abgebildet sind«.
Soweit die Übersetzung aus dem Compendium. Nach Darstellung des Prinzen Jean von Arenberg ist Arenberga das Femininum von Arn-Bergh, was «glänzender oder schimmernder Adler« bedeutet. Von den galloromanischen Schreibern sei dies zu Arembert im Masculinum umgewandelt worden.
Familiennamen der Vorgänger Heinrich II., der sich de Arberg oder Arberch nannte, sind nicht bekannt. Wenn man jedoch berücksichtigt, daß
Die Heimat der Großfamilie Arenberga, Arembert, Aremberge, Aremburge, die Freigrafschaft Burgund, kam 1034 zum Reich. Den ersten Burggrafen von Köln (Ulrich) gab es im Jahre 1032. Der Burggraf war Inhaber des wichtigsten Laienamtes in dieser Stadt und sein Amt war erblich. Stammvater der jetzigen Familie Arenberg, Burggraf Heinrich de Arberg oder Arberch, wird 1166/67 mehrfach in den Urkunden genannt. Burggrafen von Köln, Herren von Arenberg: Ulrich 1032, Franco I. 1061-1074; Arnold 1082-1095; Franco II. 1106-1135; Heinrich I. 1136-1159; Gerhard; Heinrich II. de Arberg 1166/67-1197; Eberhard comes de Arberch; Heinrich III. ; Johann, Ehe mit Katharina von Jülich, 1279 Verkauf des Kölner Burggrafenamtes; Mechtild, Ehe mit Engelbert von der Marck.
Familiennamen der Vorgänger Heinrich II., der sich de Arberg oder Arberch nannte, sind bekannt. Wenn man jedoch berücksichtigt, daß das Burggrafenamt erblich war, kann man annehmen, daß sie demselben Geschlecht angehört haben. Prinz Jean von Arenberg weist besonders darauf hin, daß »der zweimal erscheinende ungebräuchliche Vorname ‘Franco‘ darauf hindeuten könnte, daß sie aus dem Frankenland stammten«. Er führt außerdem an, daß es sehr unwahrscheinlich sei, daß ein so bedeutendes Amt wie das Burggrafenamt von Köln an eine Familie gegangen sei, die keine »Vergangenheit« und keinen Einfluß hatte. Um so wahrscheinlicher ist die These, daß die Burggrafen von Köln aus der Familie Arenberg, die von Burgund an den Rhein kam, ihren Ursprung in der Großfamilie der fränkischen Arenberga-Arembert hatten. Diese Feststellung ist auch für Aremberg von Bedeutung. Der Name der Bergkuppe und des Dorfes wäre danach von dem Namen des Geschlechtes der Arenberger abzuleiten und nicht umgekehrt.
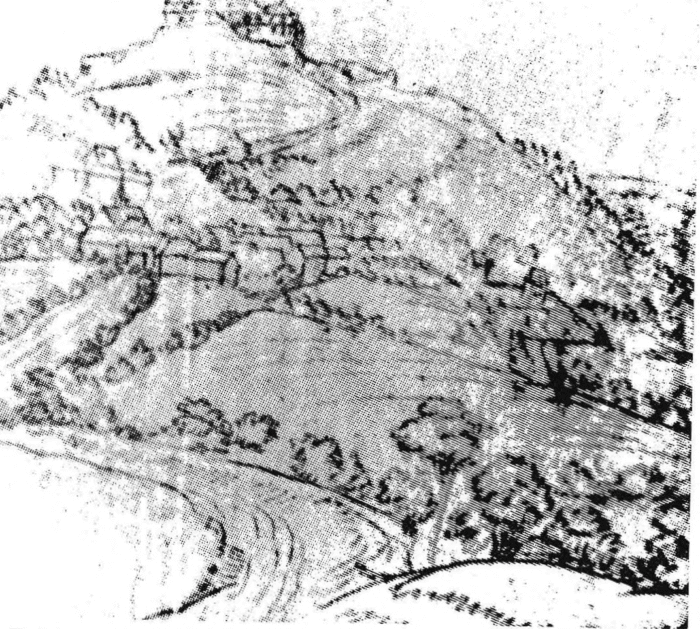
Schloß und Dorf Aremberg nach Zeichnung von Roidkin (1725)
Herrschaft Arenberg – ein Sonnenlehen in der Eifel
Die Herrschaft Arenberg mußte sich zwischen den Kurstaaten Köln und Trier und den Herzogtümern Luxemburg und Jülich behaupten. Die wirtschaftliche Macht durch den Erzbergbau und die Eisengewinnung erleichterte auf lange Zeit die Wahrung der Selbständigkeit. Zudem erwarben die Arenberger reichen Besitz im Maas- und niederländischen Raum. Für das Haus Arenberg war das Territorium in der Eifel deshalb von besonderer Bedeutung, weil es reichsunmittelbar war und keinem Lehnsherren unterstand. Zum erstenmal war diese Reichsunmittelbarkeit bereits 1280 bedroht. Mechthild von Holte, die Witwe Johanns von Arenberg, konnte damals den Nachweis erbringen, daß die Herrschaft Allodialgut war. Je mächtiger die Nachbarn waren, um so größer war die Gefahr, daß kleine Territorien ihre Selbständigkeit verloren. In manchen Fällen wurde der Kaiser um Hilfe ersucht. Der Schutz durch Kaiser und Reich bestand darin, bestimmte Rechte zu gewähren, die als Zeichen der Reichsunmittelbarkeit anerkannt waren.
Ein solches Zeichen war der Sitz auf dem Reichstag. Deshalb bemühte sich Margaretha von Arenberg um die Erhebung in den Reichsfürstenstand. Sie ließ sich von Kaiser Maximilian II. 1571 ausdrücklich die Reichsunmittelbarkeit der Grafschaft Arenberg bestätigen. Durch die Erhebung des Grafen von Arenberg in den Reichsfürstenstand 1576 erlangte sie einen Sitz auf dem Reichstag. Dadurch sicherte die Fürstin die Reichsunmittelbarkeit Arenbergs und ihres Hauses für die folgenden Jahrhunderte.
Mit dem Sitz auf dem Reichstag waren noch andere Rechte verbunden. Es durfte für das Siegel rotes Wachs verwandt werden, was sonst dem Kaiser vorbehalten war. Fremde Gerichte konnten abgelehnt werden. Zur Reichsunmittelbarkeit gehörte auch das Münzrecht als Zeichen der Souveränität. So begann im Jahre 1576 die Münzprägung der Arenberger. Das auf dem Taler von 1576 dargestellte in der Sonne eilende Jesuskind sollte andeuten, daß das Fürstentum Arenberg ein Sonnenlehen sei. In Brüssel, im Archiv des Fonds Arenberg befindet sich eine Aufzeichnung aus dem 16. Jahrhundert, die Auskunft über die Übernahme des Sonnenlehens gibt. Wenn Arenberg einen neuen Herrn erhielt, nahm dieser unter einer Linde, später im Schloßhof unter einem Baldachin, die Huldigung der Untertanen entgegen. Vorher warf er eine goldene Münze gegen die Sonne zum Zeichen dafür, daß er Arenberg von der Sonne als Lehen nahm. Die bei der Sonne zu Lehen genommenen Güter waren gleichsam himmlische Lehen, die zu keiner Dienstleistung verpflichteten.
Die Eigenschaft Arenbergs als Sonnenlehen wird in einer Aufzeichnung aus der Zeit Margarethas erwähnt und festgestellt, daß keine Ladung »auswendiger Gerichte noch vom Kaiserlichen Kammergericht jemals insinuiert oder angenommen worden« und daß man »denselbigen nicht pariert oder Folge geleistet habe«. Als ein Bote des Reichskammergerichts im Jahre 1573 eine Ladung auf Schloß Arenberg zustellen wollte, wurde er nicht eingelassen. Im Arburger Dhall, wie das Dorf früher hieß, wollte ihm niemand Nachtquartier geben. Schließlich ließ ihn der Pfarrer übernachten. Die Beschwerde des Boten und die Anerkennung des Kaisers als Oberherren bewirkten in der Zukunft einen Wandel. Im Jahre 1592 wurde von einem Boten die Klage eines Konrad von Westerholt gegen die Fürstin von Arenberg von dem damaligen Rentmeister Johann Feynhertz in Gegenwart des Burggrafen Balthasar von Keylstatt angenommen. Später geprägte Münzen mit dem Namen des Kaisers deuten darauf hin, daß das Sonnenlehnen der Oberherrschaft des Kaisers keine Konkurrenz machte.

Schloß Aremberg vor der Zerstörung
Literatur:
Clemen, Paul (Hg.): Die Kunstdenkmäler des Kreises Ahrweiler. Düsseldorf 1938.
Beitl, Richard (Bearb.): Wörterbuch der deutschen Volkskunde, 3. Aufl., Stuttgart 1974.
Heyen, Franz-Josef (Hg.): Die Arenberger. Geschichte einer europäischen Dynastie, Bd. 1: Die Arenberger in der Eifel, Koblenz 1987.
Neu, Heinrich: Das Herzogtum Aremberg. Geschichte eines Territoriums der Eifel, Euskirchen 1938.
ders.: Die Anfänge des herzoglichen Hauses Arenberg. Geschichte der Edelherren von Arenberg, Euskirchen 1942.
ders.: Aus der Geschichte der Eisenindustrie im oberen Ahrtal. In: Heimatkalender Kreis Schleiden 1953, S. 50-56.
ders.: Die Münzen und Medaillen des Herzogtums und des herzoglichen Hauses Arenberg, Bonn 1959.
Rosenthal, Gerold/ Weber, Peter (Bearb.): Aremberg in Geschichte und Gegenwart. Meckenheim 1987.
